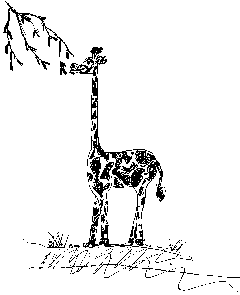|
|
||
|
|
||
|
Als selbstständiger Keramiker nehme ich seit September ‘97 an einer berufsbegleitenden Fortbildung zum Gestalter im Handwerk teil. Bei Vorüberlegungen zu einem möglichen Thema für die Abschlussarbeit hatte ich die Idee, diese in ein Entwicklungsprojekt einzubringen. Somit wollte ich ein persönliches Interesse mit der Möglichkeit verbinden, mal aus meinem üblichen Arbeitsbereich herauszukommen. Die Suche nach einem geeignetem Projekt gestaltete sich dann aber viel schwieriger als ich in meiner Blauäugigkeit erwartet hatte, letztendlich kam ich aber in Kontakt mit Penduka, einem Frauen-Selbsthilfe-Projekt in Namibia. Mit einer Managerin kam ich überein, dass ich für knapp 4 Wochen nach Penduka kommen würde, mir anschauen sollte, was sie dort machen, eventuell Produktverbesserungen vorschlagen und die Mitarbeiterinnen darauf schulen sollte. Penduka ist ein Entwicklungsprojekt für Frauen, ca. 7km ausserhalb von Windhoek am Rande des Goreanchab-Dammes gelegen. Es wurde 1992 als N.G.O. von Chritein Roos, einer holländischen Beschäftigungstherapeutin und mehreren körperbehinderten namibischen Frauen gegründet. Heute beschäftigt Penduka 28 Frauen in Vollzeit mit Herstellung und Vertrieb kunsthandwerklicher Produkte (hauptsächlich Textilarbeiten wie Batiken, Stickereien, Applikationen usw. und Keramik), Ausbildung und Weitergabe des Könnens in Workshops. Darüberhinaus gibt es Unterkünfte für Touristen und ein kleines Café-Restaurant.
|
Ca. 500 Frauen in ländlichen Gegenden ganz Namibias sind dem Projekt angeschlossen und liefern Näharbeiten, Stickereien usw., die in Penduka gegen einen Stücklohn fertig verarbeitet werden. Außerdem gibt es eine Produktion für Solarkocher, ein Recycling-Projekt und ein Bar-Restaurant in Windhoek, das auch als Veranstaltungsforum genutzt wird. Insgesamt eine ganze Menge interessanter und zum Teil auch gut funktionierender Initiativen. Bloß musste ich leider für mich feststellen, dass es die erwartete Keramikproduktion schlichtweg nicht gab. Es gab einen kleinen Raum mit einer Drehscheibe, einem elektrischen Brennofen, der nicht funktionierte, jede Menge undefinierbare Fertigglasuren und Materialien aus der Werkstatt-Auflösung einer Hobbytöpferin und den Wunsch eine laufende Töpferei zu haben. Für mich bedeutete das, meine Vorstellungen mal schnell den Realitäten anzupassen. Ich bekam drei junge Frauen zugeteilt, die ich in „Töpferei“ unterweisen sollte. Erstes Problem für mich war, dass nur eine der drei – und auch die kaum – Englisch sprach, obwohl das eigentlich die offizielle Landessprache ist. Überhaupt war die Verständigung auch in Verbindung mit der völlig anderen Mentalität für mich ein wahres Feld der Forschung und Experimente. Ich habe mich dann darauf verlegt ein paar Minimalprodukte wie Handtuchhalter, Haarspangen, kleine Dosen usw. zu entwickeln, von denen ich hoffen konnte, dass meine Schülerinnen sie nach der kurzen Zeit eigenständig herstellen können.
|
|
|
|
||
|
Die meiste Zeit war ich aber damit beschäftigt neben den Grundkenntnissen im Umgang mit Ton, solche Sachen wie Arbeitsorganisation und Planung zu vermitteln. Für mich war der Unterricht mitunter recht nervenaufreibend zumal ich praktisch jeden Tag mein Konzept vom Vortag wieder über den Haufen schmeissen musste, weil wieder etwas nicht funktionierte. Was aber sehr schön war, dass die Frauen bei allen Mentalitätsunterschieden, die ich ja auch erst mal durchblicken musste, sehr eifrig und geduldig (auch mit mir) dabei waren, so dass ich am Ende meines „workshops“ ganz zufrieden mit dem Ergebnis war. Ich hatte alle Glasuren verbannt, aus vorhandenen Tonmehlen verschiedene Engoben gemacht und mit Stempeln, Engoben und Polieren einfache Dekore entwickelt, die wir in Anlehnung an die landesübliche Feld- und Meilerbrand-Keramik nach dem Schrühen mit einem einfachen Rauchbrand etwas eingeschwärzt haben. Höhepunkt für mich war in der Zeit Meme Hilde eine alte Owambofrau, die mir zeigte wie sie in ihrer Jugend Töpfe gemacht hat. Abgesehen davon, dass mir ihre aufgebauten Töpfe gefielen, war es einfach ein Erlebnis ihr bei der Arbeit zuzusehen, mit welcher Ruhe und Eleganz sie arbeitete. Außerdem hatte ich Gelegenheit bei einem Kurzabstecher nach Owamboland bei der Herstellung der traditionellen Töpfe zuzusehen. In den meisten Gehöften gibt es eine Frau, die die Töpfe nur für den Eigengebrauch herstellt.
|
Sie arbeiten in einem mit Stämmen abgedeckten Erdloch praktisch im Dunkeln. In dieser künstlichen Höhle hält sich die Luftfeuchtigkeit und verhindert ein zu schnelles Austrocknen. (Was für meinen Workshop immer ein großes Problem war). Die Töpfe werden in einem Feldbrand bei ca. 450 Grad gebrannt und anschließend mit einem Sud aus Mopanerinde eingerieben und bekommen eine Schnur aus Rinde um die Öffnung geflochten, die den Rand etwas stabilisiert. Den Ton finden die Frauen fast überall in den Mulden in denen in der Regenzeit das Wasser zusammenläuft. Insgesamt war dieser „Arbeitseinsatz“ in Namibia eine anstrengende aber tolle Erfahrung, die ich nicht missen wollte. Für meine Abschlussarbeit zum Gestalter muss ich mir allerdings ein anderes Thema suchen, dafür war es zu elementar.
|
|
|
|
||